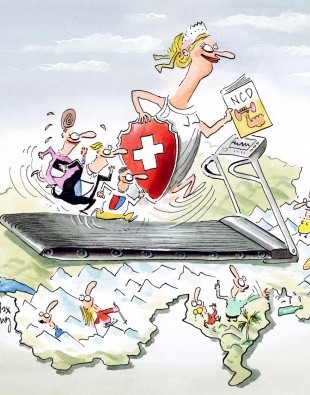Den Menschen die nötige Konsumkompetenz vermitteln
Avr. 2017End of the National Prevention Programmes
Interview mit Eveline Bohnenblust. Unsere Gesprächspartnerin ist Leiterin der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Mit ihr schauen wir zurück auf die bisherige Schweizer Drogenpolitik und schauen voraus auf die neue Suchtstrategie und die zukünftigen suchtpolitischen Herausforderungen aus der Perspektive des Stadtkantons.
spectra: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem Bund im Rahmen der drei Massnahmenpakete Drogen?
Eveline Bohnenblust: Die Zusammenarbeit mit dem BAG habe ich als sehr positiv erlebt. Die Koordination durch den Bund ist wesentlich, denn die Kantone könnten im Alleingang ihre Aufgaben nicht so effizient erfüllen. Es gibt zwar ansatzweise interkantonale Kooperationen, beispielsweise im Bereich der Spielsucht, aber das betrifft nur einzelne Aufgaben. Die übergeordnete Koordination wird vor allem durch die Koordinationsund Dienstleistungsplattform Sucht des BAG gewährleistet. Dort findet der Austausch zwischen den Kantonen, aber auch zwischen den Städten statt. So können erfolgreiche Praktiken, die in einem Kanton entwickelt werden, in den anderen Kantonen bekannt gemacht werden. Denn nicht alles muss neu erfunden werden. Andererseits können die Kantone Synergien auf der Angebotsseite nutzen.
Die Schweizer Drogenpolitik gilt seit Anfang der 90er-Jahre auch international als Erfolgsmodell. Worin bestehen aus Ihrer Sicht deren grösste Erfolge?
Die offenen Drogenszenen dieser Zeit waren leider wohl ausschlaggebend für den Durchbruch dieses Erfolgsmodells. Dadurch hat das Drogenproblem ein Gesicht bekommen. Und dadurch wurden schadensmindernde Massnahmen möglich, die ohne diesen «gesellschaftlichen Leidensdruck » kaum denkbar gewesen wären. Angefangen bei der methadongestützten Behandlung bis hin zur heroingestützten Behandlung oder den Kontakt- und Anlaufstellen. All das war gesetzlich nicht geregelt, wurde aber unter dem Druck der offenen Drogenszene möglich. Das war damals ein unheimlicher Innovationsschub. Es war die Geburt der niederschwelligen Suchtarbeit bzw. der Erweiterung der bisher auf Prävention, Therapie und Repression ausgerichteten Dreisäulenpolitik um die Schadensminderung zur Viersäulenpolitik. Der Wille zur Abstinenz war nicht mehr länger eine unabdingbare Voraussetzung, um Hilfe zu bekommen, sondern es wurde akzeptiert, dass auch Drogenabhängige Anspruch auf Hilfe haben, die noch nicht willens oder fähig sind, den Ausstieg aus der Sucht zu schaffen. Das war auch für die gesellschaftliche Diskussion wichtig. Heute sehe ich die Gefahr, dass wir einen Rückschritt machen könnten, weil die Drogenproblematik nicht mehr so öffentlich sichtbar ist. Das macht es viel schwieriger, Unterstützung und insbesondere Finanzen für schadenmindernde Massnahmen zu erhalten. Die gesetzliche Verankerung der Viersäulenpolitik im Rahmen der Revision des Betäubungsmittelgesetzes von 2011 (siehe Box) war deshalb von zentraler Bedeutung. Vorher hat man die Viersäulenpolitik zwar gelebt, aber die gesetzliche Grundlage fehlte.
25 Jahre nach der Schliessung der offenen Drogenszenen ist der Missbrauch von illegalen Drogen für die Schweizerinnen und Schweizer kein vordringliches Problem mehr. Hat die Schweiz denn heute überhaupt noch ein Drogenproblem?
Die Sucht als Phänomen wird nie verschwinden, jede Gesellschaft konsumiert bewusstseinsverändernde Substanzen, das zeigt uns die Geschichte. Es kommen immer wieder neue Substanzen auf den Markt und auch Verhaltenssüchte geraten vermehrt in den Fokus. Mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen ändern sich auch die Konsummuster. So gibt es zunehmend Hinweise, dass LSD in Mikrodosen konsumiert wird, um die Hirnleistung zu steigern – und nicht des Rausches wegen. Das entspricht den Bedürfnissen unserer Leistungsgesellschaft. Dass die Suchtproblematik heute nicht mehr so im öffentlichen Bewusstsein steht, hängt damit zusammen, dass sich die breite Bevölkerung durch die aktuellen Suchtprobleme weniger bedroht fühlt. Wenn ich selber nicht betroffen bin, was interessiert es mich, ob jemand zum Beispiel mit seinem Handykonsum Probleme hat und dieses nicht mehr ausschalten kann? Wichtig ist aber: Wenn wir von Suchtproblemen sprechen, dann sprechen wir von einem kleinen Teil der Bevölkerung. Die grosse Mehrheit kann mit Suchtmitteln umgehen.
Das Heroinelend der 80er- und 90er-Jahre bekam man in erster Linie mit einer Medizinalisierung der Suchtproblematik in den Griff – etwa durch ärztlich überwachte Konsumräume oder Substitutionsbehandlungen und Heroinabgabe. Ist dies auch der richtige Ansatz, um mit den aktuellen suchtpolitischen Herausforderungen umzugehen?
Nein, ganz gewiss nicht. Im Heroinbereich war das absolut richtig, Heroin ist eine stark abhängig machende Substanz und eine Substitution oder medikamentöse Behandlung war angebracht. Auch im Alkoholbereich geht es in eine ähnliche Richtung. Da braucht es die Medizin ab einem gewissen Punkt.
Im Bereich der neuen Substanzen, die in der Partyszene konsumiert werden, oder im Bereich Verhaltenssüchte wäre die Medizinalisierung aber der falsche Ansatz. Denn es sind ja Dinge, die in unserer täglichen Lebenswelt stattfinden. Hier braucht es viel mehr Prävention und ganz wesentlich: Früherkennung. Ab einem Zeitpunkt ist es klar eine Krankheit und dann braucht es die Medizin, aber das gilt nur für einen kleinen Teil der Betroffenen.
In den vier Säulen der Drogenpolitik wurde die Säule der Schadensminderung in der Regel mit den Überlebenshilfeangeboten wie Kontakt- und Anlaufstellen oder die Spritzenabgabe gleichgesetzt. Schadensminderung ist aber wesentlich mehr: Schadensminderung ist sicheres Nachtleben, Schadensminderung ist kontrollierter Konsum oder z.B. auch das Umsteigen vom Rauchen zu einem Vaporizer usw. Der Begriff der Schadensminderung muss erweitert und in andere Zusammenhänge eingebracht werden, nicht nur im Bereich des illegalen Drogenkonsums.
Das Hauptziel muss sein, dass die Menschen kompetent werden im Umgang mit Suchtmitteln aller Art. Dafür braucht es zielgruppenspezifische, gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass sich nicht nur die Suchtrisiken, sondern auch die Behandlungsbedürfnisse und wirksamen Interventionen über die Lebensphasen hinweg verändern. Gesundheitsförderung, Prävention und insbesondere Früherkennung sind deshalb lebenslange Aufgaben.
Wo würden Sie sich zukünftig ein stärkeres Engagement des Bundes in der Drogenpolitik wünschen?
Vom Bund würde ich mir wünschen, dass er vermehrt zu suchtrelevanten Themen und Risiken informiert. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen und Studien, die aufzeigen, dass das, was heute gemacht wird, einfach nicht mehr zeitgemäss ist. Da können wir mittlerweile auch vom Ausland lernen. Da vermisse ich vom BAG manchmal innovative Ansätze und die frühere Bereitschaft, den Lead zu übernehmen. Das Erarbeiten von solchen Grundlagen ist nicht unsere Kernaufgabe, aber wir brauchen diese, um weitere Schritte entwickeln zu können.
Nach bald zehn Jahren wäre es zudem langsam an der Zeit, das Betäubungsmittelgesetz zu überprüfen. Vor allem im Cannabisbereich wird aufgrund der internationalen Entwicklungen der letzten Jahre deutlich, dass es seinen Zweck kaum mehr erfüllen kann.
Wesentlich sind auch Weiterentwicklungen in Bezug auf die Gesundheitsförderung, die Prävention und die Früherkennung. Diese stehen jedoch unter zunehmendem Spardruck. Bundesrat Berset hat es an der Konferenz Gesundheit2020 deutlich gesagt: Es ist erwiesen, dass Prävention funktioniert und Gelder spart. Diese Botschaft, insbesondere wenn sie von höherer Stelle kommt, ist für uns Kantone und Städte von grosser Bedeutung, denn sie hilft, Unterstützung für entsprechende Massnahmen zu erhalten.